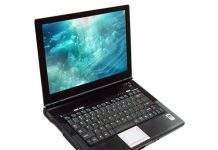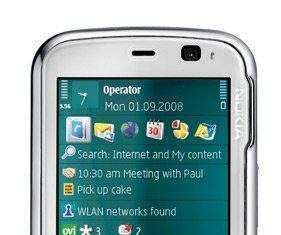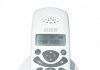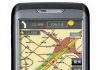Katzen faszinieren Menschen seit Jahrtausenden – sie werden als Gottheiten verehrt, als Vertraute der Hexen gefürchtet und sorgfältig gezüchtet, um unseren sich ständig verändernden ästhetischen Launen gerecht zu werden. Heute gelten sie als Internet-Sensationen und verkörpern sowohl bezaubernde Flauschigkeit als auch rätselhafte Zurückhaltung. Tim Flach, renommierter Tierfotograf, befasst sich in seinem neuen Buch „Feline“ mit dieser komplexen Beziehung, einer atemberaubenden visuellen Erkundung dieser Kreaturen, die so eng mit unserem Leben verflochten sind.
Mehr als 170 von Flachs beeindruckenden Fotografien füllen die Seiten und zeigen die Vielfalt der Katzenwelt – von schlanken Siamkatzen bis hin zu flauschigen Perserkatzen. Aber Feline geht über bloße ästhetische Schönheit hinaus. Es befasst sich mit der Wissenschaft, die hinter unserer Faszination steckt. Der Neurowissenschaftler Morten Kringelbach und der Evolutionsbiologe Jonathan Losos geben Einblicke in die Faszination von Katzen.
Ein markantes Beispiel ist Stella, eine Cornish Rex aus Kanada, deren ungewöhnliches Aussehen auf genetische Besonderheiten während ihrer Embryonalentwicklung zurückzuführen ist. Sie verkörpert die faszinierende Besonderheit, die Katzenrassen oft auszeichnet – eine Eigenschaft, die Losos in seiner Erforschung der Genetik hinter der Katzenvielfalt hervorhebt. Insbesondere weist er darauf hin, dass Katzen mit nicht übereinstimmenden Augen (häufig mit einem blauen Auge) häufig unter völlig weißen Katzen vorkommen.
Flach zeigt auch Internetstars wie Atchoum, einen langhaarigen Perser, dessen übermäßiger Haarwuchs aufgrund von Hypertrichose ihm über 900.000 Instagram-Follower eingebracht hat. Und dann ist da noch Zuu, ein exotischer Kurzhaar, der das Konzept der „Niedlichkeit“ selbst verkörpert – ein perfekt abgerundeter Flaumball, dem man nicht widerstehen kann.
Kringelbach untersucht in Feline, wie dieses Phänomen der „Niedlichkeit“ seine Magie entfaltet. Bei Säugetieren und Vögeln handelt es sich dabei um eine Strategie, die von jungen Menschen genutzt wird, um von Erwachsenen Fürsorge zu erregen. Große Augen, runde Gesichtszüge und hervorstehende Köpfe sind allgemein attraktive Merkmale von Babys, die unseren Fürsorgeinstinkt auslösen und den orbitofrontalen Kortex aktivieren, die Gehirnregion, die für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist. Diese evolutionäre Reaktion ist nicht auf unsere eigene Spezies beschränkt; Katzen aktivieren diese Belohnungszone auch beim Menschen.
In einem faszinierenden Experiment scannte Flach sein eigenes Gehirn, während er Loki, seine langhaarige Hauskatze, betrachtete. Er beobachtete, wie sein orbitofrontaler Kortex innerhalb von 130 Millisekunden aufleuchtete – eine Reaktion, die schneller war als bewusstes Denken. „Man kann sehen, wie sich Niedlichkeit entfaltet“, sagt Flach und betont die unterbewusste Kraft dieser Katzenmerkmale.
Aber Niedlichkeit ist nicht der einzige evolutionäre Vorteil einer Katze. Sie sind meisterhafte Jäger, die perfekt an ihre Beute angepasst sind. Auf einem von Flachs Bildern springt ein acht Wochen altes Sphynx-Kätzchen namens Valentine spielerisch nach einem Spielzeug und demonstriert damit seine natürliche Beweglichkeit und seinen Raubinstinkt.
Katzen besitzen einen unglaublichen Geruchssinn – bis zu 40-mal stärker als unser eigener. Ihre Schnurrhaare fungieren als fein abgestimmte Sensoren, die subtile Vibrationen erkennen, die für die Navigation in der Dunkelheit und die Annäherung an Beute entscheidend sind. Sogar ihre Zungen sind Spezialwerkzeuge: Sie sind mit Keratinspitzen bedeckt, die denen in unseren Nägeln und Haaren ähneln, und dienen nicht nur der Fellpflege und dem Essen, sondern spielen auch eine Rolle bei der Geruchserkennung. Die raue Textur hilft dabei, Pheromone auf das vomeronasale Organ am Gaumen zu übertragen.
Vielleicht ist kein Merkmal so faszinierend wie die Augen einer Katze. Historisch gesehen waren diese Kugeln von Aberglauben umgeben – ihre Helligkeit wurde als dämonische Reflexion interpretiert –, doch tatsächlich leuchten diese Kugeln dank einer speziellen reflektierenden Schicht namens Tapetum lucidum. Diese Struktur reflektiert nicht absorbiertes Licht durch die Netzhaut zurück, sodass Katzen bei schlechten Lichtverhältnissen sechsmal besser sehen können als Menschen. Losos erklärt, dass ihre hohe Dichte an Stäbchenzellen (die für das Nachtsichtvermögen verantwortlich sind) und ihre Fähigkeit, die Pupillen zu erweitern, maßgeblich zu dieser außergewöhnlichen Sehschärfe beitragen.
Flach hat außerordentliche Anstrengungen unternommen, um diese faszinierenden Augen einzufangen. Mit Spezialobjektiven und einem Hochgeschwindigkeitsblitz hat er das Tapetum lucidum auf eine noch nie dagewesene Weise eingefangen – einen schimmernden Effekt, der „einem Leuchtturmlicht, wie ein Spiegel“ ähnelt, wie Flach es beschreibt.
Feline bietet ein facettenreiches Porträt unserer katzenartigen Begleiter: wissenschaftlich aufschlussreich, visuell fesselnd und letztendlich eine Hommage an ihre anhaltende Kraft, uns zu fesseln.