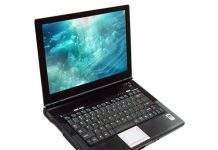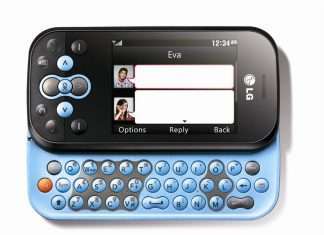Forschern gelang ein bedeutender Durchbruch in der Materialwissenschaft, indem sie stabile metallische Nanoröhren aus Niobdisulfid herstellten – eine Leistung, die lange als unwahrscheinlich galt. Die unerwartete Schlüsselzutat? Gewöhnliches Speisesalz. Diese in ACS Nano veröffentlichte Entdeckung öffnet Türen zu schnellerer Elektronik, supraleitenden Drähten und möglicherweise sogar zukünftigen Quantencomputern.
Nanoröhren sind winzige Zylinder aus aufgerollten Atomen, von denen Tausende in ein menschliches Haar passen könnten. Ihre einzigartige Größe und Struktur verleihen ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Schüttgütern außergewöhnliche Eigenschaften. Sie können stärker als Stahl, aber leichter als Kunststoff sein, Elektrizität effizient mit minimalem Widerstand leiten, Wärme effektiv übertragen und sogar ungewöhnliche Quanteneffekte aufweisen.
Diese Eigenschaften haben Nanoröhren zu begehrten Bausteinen für fortschrittliche Technologien gemacht. Bisherige Bemühungen konzentrierten sich jedoch hauptsächlich auf die Herstellung von Nanoröhren aus Kohlenstoff (Halbleiter oder Halbmetall) und Bornitrid (isolierend). Die Herstellung metallischer Nanoröhren, die sich auf atomarer Ebene unterschiedlich verhalten, erwies sich als große Herausforderung.
Metallische Nanoröhren sind aufgrund ihres Potenzials zur Supraleitung – sodass Strom ohne Widerstand fließen kann – und Magnetismus äußerst vielversprechend. „Diese Schalen können im Prinzip Phänomene wie Supraleitung und Magnetismus zeigen, die in isolierenden oder halbleitenden Versionen unmöglich sind“, erklärt Slava V. Rotkin, Professorin für Ingenieurwissenschaften und Mechanik und leitende Forscherin an der Penn State. „Frühere Versuche mit Kohlenstoffnanoröhren konnten diese Eigenschaften aufgrund der unzureichenden Elektronendichte nicht erreichen.“
Das Team konzentrierte sich auf Niobdisulfid, ein Metall, das für seine Supraleitung in Massenform bekannt ist. Es gelang ihnen, dieses Metall in unglaublich dünne Röhren – Milliardstel Meter breit – zu pressen, indem sie es um Schablonen aus Kohlenstoff- und Bornitrid-Nanoröhren wickelten.
Dieser Formgebungsprozess erwies sich als entscheidender Durchbruch: Normalerweise formt Niobdisulfid vorzugsweise flache Platten.
Die unerwartete Lösung? Eine winzige Zugabe von Speisesalz zu einem bestimmten Zeitpunkt im Wachstumsprozess. „In gewisser Weise war es wie Alchemie“, sagt Rotkin. „Man fügt diesen winzigen Inhaltsstoff hinzu und plötzlich ändert sich die Reaktion. Ohne Salz wächst das Niobdisulfid flach, mit ihm umhüllt es die Nanoröhre und bildet die Hüllen, die wir brauchen.“
Bei der Beobachtung ergaben sich weitere Überraschungen. Anstatt hauptsächlich einschichtige Röhren zu bilden, bevorzugten diese Nanoröhren eine doppelschalige Struktur – ähnlich ineinander verschachtelten Strohhalmen.
Rotkin postuliert, dass diese ungewöhnliche Formation durch elektrische Aktivität zwischen den Schichten angetrieben wird. „Mit zwei Schichten können Elektronen von einer zur anderen springen“, erklärt er, „und wirken wie ein Kondensator in Atomgröße, der die gesamte Struktur stabilisiert.“ Computermodelle unterstützen diese Theorie.
Diese einzigartige gerollte Form löst auch eine anhaltende Herausforderung bei der Arbeit mit flachen 2D-Materialien. Um aus diesen Schichten Nanodrähte herzustellen, nutzen Wissenschaftler typischerweise Lithographie – ähnlich dem Ätzen von Mustern auf Siliziumchips. Bei solch winzigen Maßstäben hinterlässt das Schnitzen jedoch gezackte Kanten, die die Eigenschaften des Materials beeinträchtigen.
„Wenn man es aufrollt“, bemerkt Rotkin, „hat man eine Hülle ohne herabhängende Bindungen. Der Durchmesser der Hülle sagt Ihnen genau, wie das Verhalten sein wird. Nanoröhren sind viel weniger zufällig als Nanodrähte, die aus zweidimensionalen Schichten geschnitten sind.“ Diese Präzision könnte metallische Nanoröhren für Anwendungen, die zuverlässige Leistung im Nanomaßstab erfordern, von unschätzbarem Wert machen.
Obwohl sich die Forschung noch in einem frühen Stadium befindet, bietet dieser Proof-of-Concept einen Einblick in spannende Möglichkeiten. „Das sind erste Ergebnisse“, erklärt Rotkin, „aber sie zeigen, dass wir metallische Nanoröhren züchten und beginnen können, ihre Stabilität zu verstehen. Von hier aus können wir darüber nachdenken, wie wir sie in Technologien integrieren können.“
Das Projekt unterstreicht die Kraft der internationalen Zusammenarbeit. „Das ist keine Arbeit, die isoliert erledigt werden kann“, betont Rotkin. „Es braucht ein Team mit vielfältigem Fachwissen, und ich hatte das Glück, Teil eines solchen Teams zu sein.“
Zukünftige Forschungen könnten den Weg für supraleitende Drähte ebnen, die eine schnellere Elektronik ermöglichen, sowie die Erforschung von Anwendungen im Quantencomputing – Technologien, die auf der Nutzung der einzigartigen Eigenschaften von Materialien im Nanobereich basieren